 Treya Wilber, in Mut und Gnade, 1991
Treya Wilber, in Mut und Gnade, 1991
Ich begegne Menschen, die krank sind, mit mehr wirklichem Verständnis, mit mehr Achtung vor der Unverletzlichkeit ihrer Person, mit mehr echtem Mitgefühl – und bescheidener, was meine eigenen Vorstellungen angeht. Allmählich erkannte ich deutlicher die Urteile, die nur notdürftig überdeckt werden von den Theorien, und die uneingestandene Angst, die noch darunter liegt. Die unausgesprochene Botschaft dieser Theorien wurde allmählich hörbar. Im Grunde sagte ich nicht: „Ich nehme Anteil an deiner Not, wie kann ich helfen?“, sondern: „Was hast du falsch gemacht? Wo hast du versagt?“ Und nicht zuletzt: „Wie kann ich mich selber schützen?“
Angst also, uneingestandene, verborgene Angst, war das, was mich trieb, Geschichten zu erfinden, in denen ich dem Universum solche Sinnzusammenhänge unterschob, in denen ich mir eine Ordnung des Universums zurechtlegte, die ich für mich ausnutzen konnte …
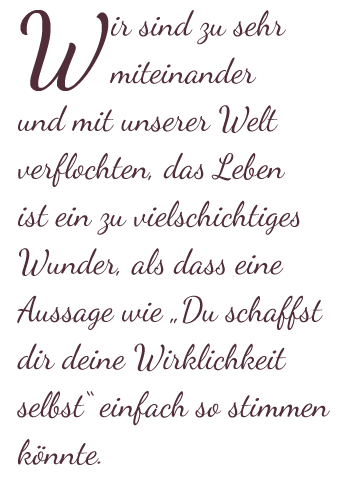 Wir sind zu sehr miteinander und mit unserer Welt verflochten, das Leben ist ein zu vielschichtiges Wunder, als dass eine Aussage wie „Du schaffst dir deine Wirklichkeit selbst“ einfach so stimmen könnte. Der Glaube, dass ich meine Wirklichkeit selber herstelle und in der Hand habe, will mich aus dem vielfältigen, geheimnisvollen und tragenden Kontext meines Lebens herausreißen. Er leugnet zugunsten des eigenen Einflusses das Gewebe der Beziehungen, von dem wir alle getragen und in dem wir alle aufgehoben sind.
Wir sind zu sehr miteinander und mit unserer Welt verflochten, das Leben ist ein zu vielschichtiges Wunder, als dass eine Aussage wie „Du schaffst dir deine Wirklichkeit selbst“ einfach so stimmen könnte. Der Glaube, dass ich meine Wirklichkeit selber herstelle und in der Hand habe, will mich aus dem vielfältigen, geheimnisvollen und tragenden Kontext meines Lebens herausreißen. Er leugnet zugunsten des eigenen Einflusses das Gewebe der Beziehungen, von dem wir alle getragen und in dem wir alle aufgehoben sind.
Im Laufe der Jahre habe ich mit vielen krebskranken Menschen gesprochen. Anfangs wusste ich nicht recht, was ich sagen sollte. Das einfachste war, über meine eigenen Erfahrungen als Krebspatientin zu sprechen, aber das war, wie ich bald merkte, häufig nicht das, was der Betreffende brauchte. Nur durch Zuhören konnte ich herausfinden, wie man wirklich helfen kann. Nur durch Zuhören konnte ich erspüren, was diese Menschen brauchten, womit sie sich gerade herumschlugen, welche Art von Hilfe in diesem Augenblick wirklich helfen würde. Die Menschen gehen im Verlauf einer so hartnäckigen und unberechenbaren Krankheit wie Krebs durch so viele verschiedene Phasen, dass man schon genau hinhören muss, um herauszufinden, was gerade ansteht. Manchmal wollen sie einfach nur Informationen, vor allem wenn verschiedene Behandlungsmöglichkeiten sich dräuend vor ihnen türmen und Entscheidungen gefällt werden müssen. Vielleicht möchten sie, dass ich sie über alternative Ansätze aufkläre oder ihnen bei der Sichtung der konventionellen Therapien helfe. Haben sie sich aber einmal für einen Behandlungsplan entschieden, dann brauchen sie meist keine weiteren Informationen mehr, und ich darf sie ihnen nicht aufdrängen, nur weil das für mich das einfachste und am wenigsten mit Angst beladene ist. Jetzt brauchen sie vor allem Rückhalt.
Wenn ich mit jemandem spreche, bei dem gerade erst Krebs festgestellt wurde oder der einen Rückfall hat oder nach Jahren des Ringens mit dem Krebs müde wird, dann muss ich, um ihm eine Hilfe zu sein, nicht unbedingt konkrete Ideen oder Ratschläge beisteuern. Zuhören ist Helfen. Zuhören ist Geben. Ich halte mich emotional zugänglich für ihn, ich suche selbst, durch meine Ängste hindurch, den Zugang zu ihm, ich versuche einfach, den menschlichen Kontakt zu erhalten. Dann zeigt sich, dass wir über viele furchtbare Dinge, wenn wir unsere Furcht nur erst zugelassen haben, gemeinsam lachen können. Ich widerstehe nach Kräften der Versuchung, für andere imperative aufzustellen, und sei es auch „Kämpf um dein Leben“ oder „Ändere dich“ oder „Stirb bewusst“. Ich versuche, die Menschen nicht in die Richtung zu drängen, die ich eingeschlagen habe oder meiner Überzeugung nach an ihrer Stelle einschlagen würde. Ich versuche, in Tuchfühlung zu bleiben mit meiner Angst, dass ich mich eines Tages vielleicht in ihrer Lage befinden werde. Ich muss von Augenblick zu Augenblick lernen, mich mit der Krankheit anzufreunden, anstatt sie als Versagen zu sehen. Ich muss meine eigenen Rückschläge und Schwächen nutzen, um für mich selbst und andere immer mehr Barmherzigkeit aufzubringen, und als ständige Mahnung, ernste Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Wenn ich überall um mich herum die sehr realen Schmerzen und Leiden sehe, die unser tätiges Mitgefühl fordern, dann versuche ich, mir stets der psychischen und spirituellen Heilungschancen bewusst zu bleiben, die in all dem liegen.

