
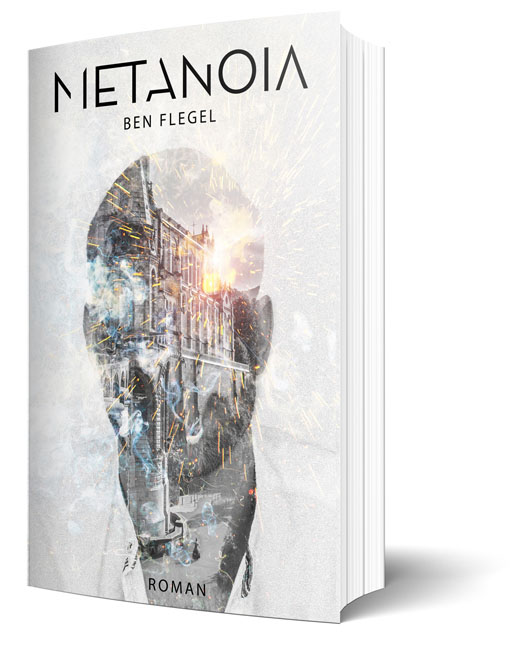
Me·ta·noia
/… nɔ͜ya, Metánoia /
Substantiv, feminin [die]
- RELIGION: innere Umkehr, Buße, spirituelle Bekehrung
- PHILOSOPHIE: Änderung der eigenen Lebensauffassung, Gewinnung einer neuen Weltsicht
- in der orthodoxen Kirche Kniebeugung mit Verneigung bis zur Erde
Die Wunde ist der Ort, an dem das Licht in dich eindringt.
Rumi
0
Vor diesem Ganzen, als mein Leben noch den Anschein erweckte, mir zu gehören, litt ich unter einer existenziellen Krankheit. Ich erinnere mich nicht daran, seit wann oder warum ich von ihr befallen war, aber seit ich denken kann, habe ich versucht, ihr zu entkommen. Was immer ich auch tat, stets holte sie mich ein. Sie war nicht von körperlicher Natur, obwohl sie so heftige körperliche Auswirkungen besaß, dass sie alles von mir riss, was mir am Herzen lag, und zu einer tödlichen Katastrophe führte, die meinen Untergang ins Rollen brachte und mich schließlich im Ganzen verschwinden ließ.
Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, in Wahrheit liegt es jedoch nur wenige Wochen zurück, dass ich meine Existenz verloren habe, mein Zuhause, meine Arbeit und meine Liebste. Und jetzt, nach dieser elendigen Flucht, auch im Kampf mit meiner Krankheit ‒ oder sollte ich sagen mit mir selbst? Ob ich tot bin oder nicht, werden einige sich jetzt fragen, allen voran meine Eltern, doch ich nicht, nicht in diesem Ganzen, denn für mich zählt nur, begriffen zu haben, dass ich die Verantwortung trage, sowohl für den Verlust meiner Liebsten als auch den Tod eines Menschen. Ich habe all das geschehen lassen.
Als Flüchtender habe ich gelernt, dass es nichts bringt, in fremde Länder zu fliehen, in reizvolle Annehmlichkeiten oder in die Dumpfheit des Alkohols, denn wenn die Krankheit aus der eigenen Existenz kommt, ist jede Flucht vergebens. Selbst die Flucht nach innen rettet einen nicht, jedenfalls nicht für lange; ich sollte es wissen, denn ich habe es mit allen Mitteln versucht. In die Schutzräume meiner eigenen Psyche zu flüchten hat dabei noch bei weitem am besten funktioniert; in ihnen fand ich Sicherheit, verdrängte meine Krankheit ‒ und ich vergaß sogar, dass ich das tat. Ich verschwand in einem Raum aus Spiegeln, die nur das reflektierten, was ich sehen wollte. Ich verhinderte zwar meine Heilung, doch das nahm ich nahezu wissentlich hin, schließlich hatte ich lernen müssen, mich zu schützen, alle voran vor meiner Krankheit. Natürlich hätte ich ahnen können, dass es schwerwiegende Folgen haben würde, doch das wollte ich nicht wahrhaben.
Verdrängung ist gerade deshalb das stärkste aller Fluchtmittel, weil sie sich kaum unterscheiden lässt vom eigenen Selbst; früher oder später wird sie zu etwas, mit dem man identifiziert ist, das man Selbst nennt ‒ sie wird also unsichtbar. Wenn man schließlich in sich danach sucht, findet man nichts mehr. Mit anderen Worten: Auffindbar sind nur diese Spiegelbilder, verzerrt und beschönigt, nicht jedoch das, was sie hervorbringt, nicht das verdrängte Selbst. Erst als die Katastrophe mein ganzes Leben hinfort spülte, bekamen die Spiegel Risse, und die vergessen geglaubte Krankheit drängte mit aller Gewalt in mein Bewusstsein zurück. Ich konnte nichts von dem, was mich wie eine Welle überkam, begreifen, weder meine Körperempfindungen noch meine Gedanken, Gefühle oder Träume, dennoch erkannte ich alles wieder; es war das Störecho. Seit Kindertagen habe ich meine Krankheit so bezeichnet, und diese trügerische und zugleich untrügliche Gewissheit existenziellen Alleinseins war schon immer ihr Herz.
Auf den ersten Blick hatte meine Krankheit also nichts mit der Welt zu tun, in der ich lebte. Krieg, Gewalt und durch Menschen geschaffene Katastrophen waren zwar allgegenwärtig und machten die Krankheit des Ganzen deutlich, doch das beschäftigte mich kaum, da ich auch vor dieser Realität geflohen war. Mein Bedürfnis nach Ganzheit schien in der äußeren Welt nicht mehr erfüllbar zu sein, und zu bezeugen, wie sie immer weiter im Chaos versank, war zu viel für meinen empfindsamen Charakter. Wo andere Menschen Angriff oder Resignation wählen, um sich Krankheit vom Leib zu halten, wählte ich Flucht. Sich selbst an die erste Stelle zu stellen, dieser störrische Eigensinn des Einzelnen gegenüber dem Ganzen, mag vielleicht die größte Hürde des Menschen auf dem Weg in die Freiheit sein, aber im Grunde ist das nichts Neues. Dass das Einzelne und das Ganze jedoch überhaupt als getrennt erscheinen, ist der eigentliche Trugschluss, der bei näherer Untersuchung ebenso offensichtlich ist wie jener, dass Krankheit woanders überwunden werden kann als dort, wo sie entsteht.
Obwohl es hier, in diesem Ganzen, noch immer Krankheit gibt, so gibt es jetzt auch eine unausweichliche Trauer im Bewusstsein der katastrophalen Folgen meines bisherigen Verdrängens, meiner selbst bezogenen, unser aller Sein betreffenden Flucht, die nicht einmal vor meiner Liebsten, die ich heute mehr vermisse denn je, Halt gemacht hat. Weder die Trauer noch die Erkenntnis kann überwunden werden, überwunden werden kann nur die Krankheit. Dieser Ort also, an dem das Einzelne und das Ganze gemeinsam entstehen, und mit dem Trugschluss ihrer Getrenntheit die Krankheit, befindet sich tief im Inneren des Ganzen, und etwas Unsagbares versteckt sich hier seit Anbeginn. Was es ist, ist weder einfach zu ergründen noch überhaupt zu beschreiben. Jene jedoch, die es ergründen, überleben es nicht ‒ im Grunde gibt es also niemanden, der darüber sprechen kann. Dennoch: Die Menschen, die ihr Leben dafür geben, sind die einzigen, die davon erzählen können und dazu verpflichtet sind entsprechend ihren Neigungen und ihrer Natur. Ihre Berichte sind in jeder erdenklichen Sprache verfasst, doch an keine einzige gebunden. Sie alle erzählen von Ewigkeit und Liebe, und von Krankheit und Verdrängung, und sie alle beginnen mit den einfachen Worten: Ich bin.
1
Obwohl es mich drängt, mit einem spitzen Gegenstand die Zugfenster zu zerkratzen, bleibt mein Körper überraschend ruhig, als gingen die Symptome ihn nichts an. Ihre Heftigkeit hat zwar nicht abgenommen, die Häufigkeit ihres Auftretens aber auch nicht zugenommen, seitdem diese Krankheit vor einer Woche in mein Leben zurückgekehrt ist. Leider verhält es sich bei ihr so, dass man sie mir nicht ansieht, geschweige denn, dass es überhaupt eine Krankheit ist. Eine ärztliche Untersuchung hat es nie gegeben, und ob sie zu meiner Heilung beitrüge, falls ich je eine durchführen lassen sollte, kann ich nicht beurteilen. Im Grunde spielen solche Fragen auch keine Rolle, ich bin ohnehin schon zu weit geflüchtet. Vor nahezu allem, denke ich. Sollte ich mich also wider meine Beherrschung an den Zugfenstern vergehen, und sollte daraufhin jemand den Schaffner holen, darf ich keine mildernden Umstände erwarten. Wenn nicht einmal meine Vertrauten sie mir zubilligen, kann ich bei Fremden erst recht nicht damit rechnen; diese Unterscheidung zu treffen ergibt jedoch keinen Sinn mehr. Genauso wenig wie die Unterscheidung zwischen Nähe und Ferne, zwischen Bewusstsein und Gewissen, zwischen Liebe und Verlust. Keine ändert etwas an meinem Verlangen, irgendeinen Schaden anzurichten ‒ vorgeblich deshalb, weil die himbeerfarbenen Sessel dieses Abteils scheußlich sind und mir Kopfschmerzen bereiten, wodurch weitere Komplikationen entstehen; ich könnte ein Loch in eine der Himbeeren brennen.
Die letzten Minuten waren trügerisch. Ich habe diesen Streckenabschnitt ohne nennenswerte Ausfälle überstanden, doch ich spüre es kommen. Seitdem eine Ewigkeit in Montauban gehalten wurde, was mir merkwürdigerweise nicht zugesetzt hat, obwohl es heftige Symptome hätte hervorrufen können, hat mein Verstand sich halbwegs friedlich verhalten. Es heißt jetzt, nicht eine Sekunde darauf zu vertrauen, es könnte von Dauer sein, also halte ich der Unbeschwertheit den Verdacht entgegen, es handle sich um eine Täuschung, die mich abrupt der Gewalt der Vergangenheit ausliefert, einem wiederkehrenden Aufruhr psychischer Irrgänge. Nichts anderes vermag ich zu tun, als mich nach Kräften dagegen aufzulehnen, es hinauszuzögern, bis über kurz oder lang das Störecho anrückt, die Filmfetzen, und sich zwischen meine Gedanken drängt, um meinen Verstand daran zu erinnern, dass ich mich selbst zu heilen nicht fähig bin. Ich kann es nicht steuern, ich kann meinen Tod nicht aufhalten. Die Bilder gehorchen mir nicht ‒
Insel. Schwarzer Sand. Ich renne über die Straße den Hügel hinauf, hinein in eine enge Gasse. Erste Kreuzung. Ich drehe meinen Kopf nach allen Seiten, eile rechts zu einigen Treppenstufen. Sie führen nach oben. Mein T-Shirt ist klatschnass, Schweiß läuft über meine Stirn. Ich renne die Treppenstufen hinauf, doch sie finden kein Ende. Je weiter ich renne, desto mehr Stufen tauchen auf. Die Gasse wird enger. Ich will nach Hilfe schreien, doch ich bringe keinen Ton heraus. Mein Herz tut weh, es drückt schwer in meiner Brust. Meine Uhr schlägt gegen eine Hauswand und fällt zu Boden. Mit einem Mal stecke ich fest. Ich winde mich rückwärts heraus, mache kehrt und eile die Stufen wieder hinunter bis zur ersten Kreuzung. Alle Gassen sehen gleich aus, ich weiß nicht wohin. Es gibt keine Schilder, keine Menschen, kein Leben. Es ist totenstill, die Luft ist flirrend heiß, meine Beine sind schwer. Ich renne weiter, jetzt nach links. Überall sind Kreuzungen und Gassen, die gleichen unbewohnten Häuser. Mein Herz drückt immer schwerer. Angst überkommt mich. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe ‒ da gelange ich an einen offenen Platz. Hinter mir höre ich das Meer. Vor mir ist ein Hügel mit vielen Palmen. Zwischen ihnen sehe ich die Haltestelle. Ich gebe einen Schrei von mir und will hinaufrennen, doch mein Körper fühlt sich seltsam an. Meine Knochen fangen an zu glühen. Das Gewebe in meinem Rumpf wird unruhig und heiß, als bewegten sich glühende Steine in meinem Herzen. Plötzlich fällt ein Stein aus meiner Brust. Es bildet sich ein Brandherd. Ein weiterer Stein fällt aus meinem Bauch, aus meiner Leber, meiner Kehle. Nach und nach fallen unzählige glühende Steine wie lebendige Wesen aus meinem Körper. Kaum sind sie durch die Haut, fallen sie zu Boden und verschmelzen mit meinen Füßen. Ich kann meine Beine nicht heben. Unermessliche Angst überkommt mich. Ich höre, wie der Motor des Busses startet. Ich nehme meine Kraft zusammen und beginne zu rennen, doch ich komme kaum voran. Jeder Schritt schmerzt, meine Beine drohen zu bersten. Ich bin nicht schnell genug. Ich wirble mit den Armen umher und schreie laut nach dem Bus, stolpere und falle zu Boden. Mein Kinn schlägt auf den Asphalt, und ich beginne zu bluten. Ich hebe meinen Kopf und strecke meinen Arm aus, doch der Bus fährt bereits los. Ich sehe einen Lichtstrahl auf dem Rückfenster, bevor er zwischen den Palmen verschwindet. Ich kann mein Herz fast brechen hören. Ich denke an sie und den freien Platz neben ihr. Dann tosender Lärm. Ich ahne, was jetzt kommt. Ich drehe mich um. Eine meterhohe, schwarze Wasserwand erstreckt sich über die gesamte Breite des Ozeans und rast mit tödlicher Geschwindigkeit auf mich zu. Ich blicke auf meine versteinerten Füße und weiß, noch in diesem Moment werde ich sterben.
Von Berlin nach Basel, von Basel nach Dijon, dann über Lyon nach Toulouse, jetzt von Toulouse nach Agen; das sind fast zweitausend Kilometer durch Mitteleuropa, mitbekommen habe ich davon nichts, doch mir hängt jeder Kilometer wie Blei in den Knochen. Wenn ich hinausschaue, sehe ich Platanenalleen zwischen den Nebenkanälen der dreckigen Garonne, ich sehe dunkle Einöde, ich sehe die Kühltürme eines Atomkraftwerks und hoffe, ich bin bald da.
Als der Zug in Agen einfährt und dann stockend im Bahnhof zum Stehen kommt, steige ich endlich aus. Plötzlich spüre ich das körperliche Ausmaß dieser Schwere, dieser eigenen Unbewegtheit; in meinem Kopf und in meinem Brustkorb, in meinen erschöpften, angespannten Gliedern, in den steifen Gelenken meiner Füße. Franz steht schon am Gleis, ganz hinten am anderen Ende, aber selbst aus dieser Entfernung ist er bei seiner Körpergröße und Breite schnell zu erkennen. Während ich auf ihn zulaufe, sehe ich, wie er erleichtert lächelt. Wir begrüßen uns wortlos mit einem Kuss auf die Wange, links, rechts, dann gehen wir zu seinem Auto, einem alten Renault Quatrelle aus dem Jahr fünfundsechzig, und verladen mein Gepäck; seine kräftige Hand unentwegt auf meiner Schulter.
Nachdem wir uns in dem engen Gefährt nebeneinander ausreichend Platz verschafft und die Türen geschlossen haben, sagt er: Eine Dreiviertelstunde Fahrt haben wir noch vor uns, lehn dich zurück, du siehst schauerlich aus. Wie lange warst du unterwegs?
Fünfzehn Stunden.
Ich bilde mir ein, in seinem Gesicht die Frage lesen zu können, warum ich ihn nicht um ein Flugticket gebeten habe. Ich könnte sagen, es ist der Unterschied zwischen verschwinden und sich entfernen, ich könnte sagen, dass die Flucht durch die Luft nur aus Einsteigen und Aussteigen besteht und man sein Gepäck nicht am Körper trägt, aber ich bin müde, und wir haben noch Zeit, ich sage: Eigentlich müsste ich jetzt arbeiten, die Bar beaufsichtigen oder am Empfangstresen stehen und den Gästen ihre Plätze zuweisen. Vielleicht würde ich ihnen auch das Essen an den Tisch bringen. Stattdessen lasse ich mich in einem Oldtimer durch Frankreich kutschieren.
Erfreulicherweise gibt es hier keine Züge, die dich bis kurz vor die Haustür bringen, erwidert Franz, steckt die Lasche seines Gurtes in die Vorrichtung und fügt hinzu: Ich hoffe ja, so bald wie möglich über die Umstände deines plötzlichen Besuchs aufgeklärt zu werden.
Als er dabei seine Hände in den Schoß legt und sein Gesicht lächelnd zu mir dreht, erfasst mich unversehens eine tiefe Zuversicht, die von ihm ausgeht und von der man fälschlicherweise meinen könnte, sie habe mit Franz’ fortgeschrittenem Alter zu tun, obwohl es doch sein eigenes Verdienst ist, sie sich bis heute erhalten zu haben. Seine Überzeugung ‒ davon hat er mir einmal erzählt ‒ dass es ihm an nichts mangeln werde, dass das Leben sich großzügig um jene kümmere, die sich, selber großzügig, um Menschlichkeit bemühen, strahlt von ihm aus und wirkt beruhigend auf mich. Allein wenn sein Mund sich zu einem Lächeln formt; mein Vertrauen in diesen ist Menschen ist groß.
Ich kann dir zumindest versichern, sagt er schließlich, dass du auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hast. In der Abgeschiedenheit der Gascogne wirst du alles finden, was dir in Berlin nur als Ziel deiner Sehnsucht vertraut war.
Er startet den Motor und fährt hinaus aus der kleinen Stadt, durch das Tor der Stadtmauer und über die lange Garonnebrücke. Hinein in die campagne!, kommentiert er, bevor sie uns mit einem Mal restlos umgibt; zu sehen ist nichts außer Schwarz über dem Land und Leuchtpunkten im Himmel, während die Lichtkegel des Wagens nicht weiter reichen, als die schmalen, freien Straßen es von ihnen verlangen. Wenn wir Glück haben, unterbricht Franz die Stille, begegnet uns, bis wir zuhause sind, kein einziges Auto. Und tatsächlich bleiben wir auf der restlichen Strecke allein, die uns durch eine Hügellandschaft führt, durch unzählige Täler und an Anhöhen entlang, zweimal passieren wir einen kleinen, alten Ort, bis Franz plötzlich sagt, im Dunkeln sei die Grazie der Gascogne nicht zu erkennen: Eingegrenzt von der Atlantikküste im Westen, den Pyrenäen im Süden und dem Mittelmeer im Osten, in der Region Midi-Pyrenäen gelegen, besitze die Gegend neben den weiten, wie wohlgeformte Hintern geschwungenen Hügeln wundervolle Talauen mit grünen Fluren, gelben Sonnenblumenfeldern und Raps, aber auch Wein an den Hängen, Eichen- und Kiefernwälder, Zypressen, Pappeln und vereinzelt auf den Feldern stehende Schirmpinien, die im Sommer Schatten spenden. Dazwischen thronten die vielen herrschaftlichen Anwesen wie von Gott gesät, ebenso prächtige Sakralbauten und historische Bastiden, mittelalterliche Reißbrettstädte, von denen es hier noch mehr als vierhundert gebe, eine davon hätten wir gerade durchfahren. Wenn darüber hinaus am Tag das Licht diesen Landstrich überflute ‒ ergötzt sich Franz an seinen Beschreibungen ‒ und die Farben mit finalem Pathos aufleuchten, das Gebirge der Pyrenäen am Horizont und einen Hauch von ferner Meeresluft in der Nase, wenn man sich letzteres wenigstens vorstelle, dann überfielen einen nur noch Ergriffenheit und Glück. Ich nicke und bekunde meine Neugier, anschließend sprechen wir für den Rest der Fahrt kein Wort mehr, er nicht aus Konzentration oder Enttäuschung über mein spärliches Interesse, ich nicht aus Erschöpfung oder Teilnahmslosigkeit, das weiß ich nicht; vielleicht auch, weil diese so genannte gottgeweihte Gegend es nicht vermag, die Vergangenheit von mir fern zu halten; erneut überfällt mich der Drang, die Scheiben zu zerkratzen, mit der metallenen Lasche des Autogurtes oder mit dem Eiskratzer im Seitenfach oder schlicht mit irgendetwas, das sich dafür eignet; ich lehne mich dagegen auf, schaue hinaus ins Dunkel und versuche vergeblich, meine Gedanken auf etwas anderes zu richten.
Insel. Schattenseite. Der Hafen ist düster, nur ein einziges Schiff wird von der Sonne berührt. Lichtstrahlen reflektieren von der Reling. Es ist kein Mensch zu sehen. Ich renne über die Straße Richtung Steg, so schnell ich kann. Schlaglöcher tauchen plötzlich im Boden auf, unmittelbar vor meinen Füßen. Ich weiche ihnen aus, renne weiter. Die Schlaglöcher vermehren sich, mit jedem Schritt werden es mehr. Sie werden größer und tiefer, tauchen nahezu unter meinen Füßen auf. Ich schlage Haken, werde langsamer. Überall sind Schlaglöcher. Ich kann kaum mehr auftreten, versuche, in Bewegung bleiben. Mein Herz tut weh, es drückt schwer in meiner Brust. Dann ein Hupen. Ich schaue auf, und das Schiff ist verschwunden. Ich drehe mich nach allen Seiten. Plötzlich ist es hinter mir. Also mache ich kehrt und renne in die andere Richtung, weiche den Schlaglöchern aus wie ein Irrer, trete falsch auf, stolpere und falle. Ich richte mich schnell wieder auf, gelange auf die Füße. Mein Herz drückt immer schwerer in meiner Brust, Angst überkommt mich. Ich muss auf das Schiff. Schweiß läuft meinen Rücken hinunter. Mein Körper wird heiß, mein Bauch ist angespannt. Brandherde bilden sich auf meiner Brust. Glühende Steine fallen heraus und verschmelzen mit meinen Füßen. Jeder Schritt schmerzt. Meine Knochen glühen, ich werde langsamer. Tausende Brandherde bilden sich auf meinem Körper, aus ihnen fallen ununterbrochen glühende Steine. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Da höre ich ein weiteres Hupen und sehe, wie das Schiff vom Steg ablegt. Sie steht an der Reling, mit dem Rücken zu mir. Ich schreie nach ihr, aber sie hört mich nicht. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, renne die letzten Meter und gelange zum Steg. Plötzlich höre ich ein lautes Knacken. Ich schaue nach unten. Die Holzbretter biegen sich unter dem Gewicht meiner versteinerten Füße. Ein letztes Hupen. Ich sehe, wie das Schiff im Sonnenlicht verschwindet. Ich kann mein Herz fast brechen hören. Dann fällt der Steg auseinander, und ich stürze in die Tiefe. Ich schaue zwischen meinen Füßen hindurch und sehe eine schwarze Wasserfront, die mit rasender Geschwindigkeit auf mich zukommt. Jede Zelle meines Körpers erstarrt, und ich weiß, noch in diesem Moment werde ich sterben.
Inmitten der Einsamkeit zweier emporragender Hügel zwischen Astaffort und Castéra-Lectourois befindet sich das Anwesen, und ich bezweifle, je wieder allein von hier zurückzufinden, sollte ich einmal dazu genötigt sein. Franz hat mein Gepäck bereits ins Haus gebracht, während ich noch neben dem warmen Auto stehe und auf das Gebäude vor mir blicke; eine ehemalige Wehrfestung aus dem fünfzehnten Jahrhundert, im Hotel hat er einmal ausführlich davon erzählt. Ein britisches Ehepaar ‒ Antiquitätenhändler aus Birmingham ‒ hatte darin gelebt, bis sie sich gegenseitig fast die Köpfe einschlugen. Um ein Unglück zu vermeiden, reichten sie die Scheidung ein, auch beabsichtigten sie, das Anwesen zu verkaufen, woraufhin ein maßloser Streit um die besonderen Möbel, die sie jahrzehntelang gesammelt hatten, noch weiter entzweite. Der Streit führte das Paar vor Gericht; die Frau bekam Recht und damit nahezu alle Antiquitäten, der Mann nahm sich das Leben. Fünf Tage nach dem Prozess, unter einem Feigenbaum nur wenige Meter vom Haus entfernt, schoss er sich mit einer englischen Steinschlosspistole der frühen Kolonialzeit in den Mund und verteilte die Hälfte seines Kopfes auf dem kiesigen Vorplatz. Seine Frau ließ ihn umgehend einäschern und auf dem örtlichen Friedhof begraben, während sie ebenso umgehend zurück nach Birmingham zog; die Trauerfeier war für sie nicht von Bedeutung. Seither kommt sie jedes Jahr zur gleichen Zeit in die Gascogne und verbringt hier ihren Urlaub. Doch Franz sagt, über etwas anderes als Landschaft und Antiquitäten sei mit ihr nicht zu reden.
Für eine ehemalige Militärfestung, ein Château Fort, ist es kleiner, als ich es mir vorgestellt habe, als könnte man tatsächlich darin wohnen, ohne sich in jedem Raum verloren vorzukommen. Das Gemäuer sieht aus, als wäre es über die Jahrhunderte enger zusammengewachsen; ein runder Turm ragt vom Boden bis über die drei Stockwerke hinaus, unten von Efeu umrankt, oben mit überstehenden Ziegeln und einer Bronzefigur in der Mitte des Kegeldachs, im Dunkel erkenne ich jedoch nur einen gebogenen Lichtstreifen, der darauf glänzt. Die Fenster und Türen des Châteaus sind von weißen Holzläden eingefasst, mit Ausnahme der Schießscharten im Turm, die mit kleinen Glasscheiben geschlossen worden sind. Franz tritt aus einer der Türen ins Freie und hält eine Flasche und zwei Gläser in der Hand.
Komm! Das Haus zeige ich dir morgen. Jetzt trinken wir einen.
Er läuft um das Gemäuer und setzt sich auf einen der gepolsterten Baststühle, die unter einer Außenüberdachung zu einem Halbkreis angeordnet sind. Armagnac, sagt er, hier aus der Gegend. Er reicht mir ein Glas herüber und zieht eine Packung Zigarillos aus der Brusttasche, reicht mir auch davon einen, dann stoßen wir an und beginnen zu rauchen. Es ist sternenklar und still, nur ein unbestimmtes Fiepen dringt gelegentlich aus der Dunkelheit. Seltsamerweise riecht es nach Koriander.
Autor
 Ben Flegel, geboren 1989, lebt in Berlin und arbeitet als Meditationslehrer und Autor. Im Jahr 2004 überlebte er den Tsunami in Südostasien und begann anschließend, Mystik und Literatur zu studieren. 2012 initiierte er die Gründung einer Jugendorganisation für Bewusstseinsarbeit, Young Vision e.V., für die er eine Vielzahl an Workshops leitete. Nach seiner Rückkehr von einem zweijährigen Mediationsretreat, das einen Wendepunkt in seiner eigenen Praxis darstellt, gründete er 2017 das Meditationslabel More than Meditation, über das er Meditationskurse, Workshops und Coachings anbietet. Seit 2019 ist er Teil des Berliner Lehrer-Kollektivs nine yoga - the healing arts.
Ben Flegel, geboren 1989, lebt in Berlin und arbeitet als Meditationslehrer und Autor. Im Jahr 2004 überlebte er den Tsunami in Südostasien und begann anschließend, Mystik und Literatur zu studieren. 2012 initiierte er die Gründung einer Jugendorganisation für Bewusstseinsarbeit, Young Vision e.V., für die er eine Vielzahl an Workshops leitete. Nach seiner Rückkehr von einem zweijährigen Mediationsretreat, das einen Wendepunkt in seiner eigenen Praxis darstellt, gründete er 2017 das Meditationslabel More than Meditation, über das er Meditationskurse, Workshops und Coachings anbietet. Seit 2019 ist er Teil des Berliner Lehrer-Kollektivs nine yoga - the healing arts.
In 2019 beendete er das Timeless Wisdom Training, geleitet von Thomas Hübl. Letzerer gehört neben Ken Wilber und David Deida zu seinen wichtigsten Lehrern. Im November 2019 erschien Metanoia, sein erster Roman. Für mehr Informationen klicken Sie bitte auf die entsprechenden Webseiten.
Ben Flegel
Metanoia
Format: Kindle Ausgabe
Dateigröße: 638 KB
Seitenzahl der Print-Ausgabe: 224 Seiten
Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (25. November 2019)
Sprache: Deutsch
ASIN: B081Z7PLQP
Die Medieninhalte und alle weiteren Beiträge dieser Homepage finanzieren sich über Euch, unsere Leser:innen.
Bitte unterstützt uns nach Euren Möglichkeiten – egal ob mit einer kleinen oder größeren Einzelspende oder einer monatlichen Dauerspende.

